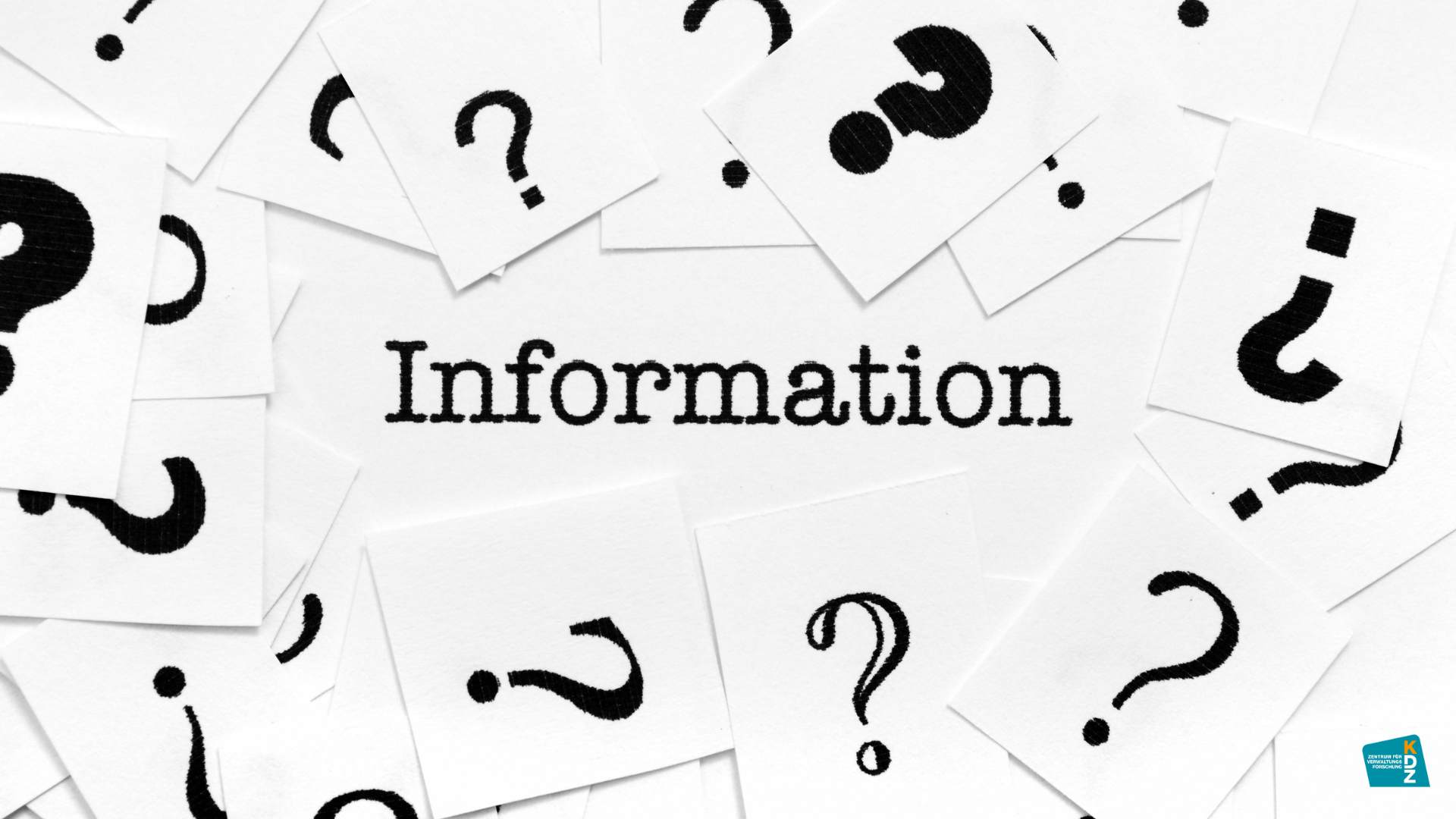Mit dem 1. September 2025 steht in Österreich ein grundlegender Wandel in der Verwaltung an: Die Amtsverschwiegenheit wird durch die Informationsfreiheit abgelöst. Diese Neuerung betrifft alle staatlichen Institutionen, ganz besonders aber Gemeinden. Häufig sind diese erste Anlaufstelle für die Bewohnerschaft und verfügen über vielfältige Informationen. Die bevorstehende Veränderung birgt sowohl Chancen als auch Herausforderungen, die bereits Gegenstand zahlreicher Fachveranstaltungen waren und von der Wissenschaft intensiv untersucht werden.
Am 28. Februar 2025 fand daher an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Sigmund Freud Privatuniversität eine Tagung mit rund 140 Teilnehmenden statt. Dabei kristallisierten sich die folgenden wesentlichen Ergebnisse heraus:
- Notwendiger Schritt in Richtung Transparenz
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Informationsfreiheitsgesetz – obwohl es gerade für Gemeinden auch einen zusätzlichen Arbeitsaufwand bedeutet – einen entscheidenden Schritt hin zu einer offeneren und demokratischeren Gesellschaft darstellt. Eine transparente Verwaltung schafft nicht nur Rechtssicherheit und verhindert Machtmissbrauch und Korruption, sondern fördert auch das Vertrauen in öffentliche Institutionen. Gerade in der heutigen Zeit ist das
öffentliche Vertrauen ein entscheidender Faktor für das Funktionieren der Demokratie. Offenheit und Transparenz sind daher unerlässlich.
- Noch offene Detailfragen
Obwohl die grundsätzliche Notwendigkeit des IFG unbestritten ist, bleiben einige Detailfragen noch ungeklärt. Dazu zählt insbesondere der Umfang der Veröffentlichungspflicht im Bauverfahren. Zudem ist das Verhältnis zwischen IFG und DSGVO noch nicht ausjudiziert. Es kann daher vorkommen, dass eine Gemeinde aufgrund des IFG verpflichtet ist, bestimmte Informationen zu veröffentlichen, die Datenschutzbehörde im Nachhinein jedoch feststellt, dass diese Veröffentlichung gemäß der DSGVO unzulässig war. Die Datenschutzbehörde arbeitet jedoch an entsprechenden Unterstützungsmaterialien und bietet Schulungen auch in den Bundesländern an, um hier für mehr Klarheit zu sorgen.
- Bereits mittelfristig kaum erhöhter Arbeitsaufwand zu erwarten
Ein weiterer Punkt der Tagung war der zu erwartende Mehraufwand in der Anfangsphase nach Inkrafttreten des IFG am 1. September 2025. Die Kommunalverwaltung wird vorübergehend mit einem erhöhten Ausmaß an Informationsanfragen beschäftigt sein. Dabei zeigen jedoch Erfahrungen aus anderen Ländern, dass sich diese anfängliche Häufung an Anfragen binnen kurzer Zeit wieder normalisiert. Gemeinden, die frühzeitig und um fassend Informationen proaktiv veröffentlichen, werden mit deutlich weniger Arbeitsaufwand durch individuelle Anträge konfrontiert sein. Dieser proaktive Ansatz hilft, spätere Einzelfragen zu minimieren, und in vielen Fällen genügt dann ein einfacher Verweis auf die bereits veröffentlichte Information.
- Notwendigkeit eines Kulturwandels
Eine zentrale Erkenntnis der Veranstaltung war, dass der Erfolg des IFG nicht allein von der präzisen Auslegung der rechtlichen Bestimmungen abhängt. Vielmehr ist ein tiefgreifender Kulturwandel in der Verwaltung notwendig – ein neues Selbstverständnis, das sicherstellt, dass die langfristigen Ziele, wie eine Stärkung des Vertrauens der Bewohnerschaft, realisiert werden können.
In diesem neuen Bewusstsein sollte das IFG vonseiten der Verwaltung nicht als bürokratische Bürde, sondern als Chance verstanden werden, die Beziehungen zwischen Bewohnerschaft und Verwaltung nachhaltig zu verbessern. Neben der Tagung hat die rechtswissenschaftliche Fakultät der Sigmund Freud Privatuniversität
ein Forschungsprojekt ins Leben gerufen, um zum Verständnis der im Zusammenhang mit dem IFG auftretenden Fragestellungen beizutragen. Dieses verfolgt einen mehrstufigen Ansatz:
Sammlung der Fragestellungen
Durch ein partizipatives Verfahren werden Gemeindebedienstete aktiv eingeladen, ihre konkreten Fragen über ein Onlineformular einzureichen. Diese Fragen dienen als Grundlage für eine „Law Clinic“, bei der Studierende zusammen mit Fachpersonen der Rechtsanwaltskanzlei Cerha Hempel eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Themen vornehmen.
FAQs
Aus der erfassten Bandbreite an Fragen entsteht ein fortlaufend aktualisiertes FAQ-Dokument, das – basierend auf den Regelungen des IFG – kontinuierlich mit Antworten ergänzt wird, die auf den Vorgaben des Informationsfreiheitsgesetzes beruhen.
Rechtsdogmatische Analyse
Besonders relevante Fragestellungen werden einer fundierten rechtsdogmatischen Analyse unterzogen, deren Ergebnisse in Fachpublikationen publiziert werden.
Rechtssoziologische Analyse
Das Projekt untersucht Zusammenhänge zwischen kommunalen Faktoren, wie etwa der Gemeindegröße, und den typischerweise auftretenden Fragestellungen.
Die Ergebnisse dieses partizipativen Ansatzes werden wertvolle Erkenntnisse darüber liefern, wie Gemeinden den Übergang zur Informationsfreiheit praktisch gestalten können und welche Anpassungen des IFG eventuell erforderlich sind. Wir laden alle in der Gemeindeverwaltung oder in den kommunalen Betrieben tätigen Personen ein, an unserem Forschungsprojekt mitzuwirken und die Umfrage auszufüllen.
Der Übergang zur Informationsfreiheit verlangt also mehr als nur juristische Klarstellungen. Er erfordert ein Umdenken in der Arbeitsweise der Gemeindeverwaltungen – einen Kulturwandel, der darin besteht, dass Behörden die neuen Transparenzpflichten konstruktiv umsetzen.