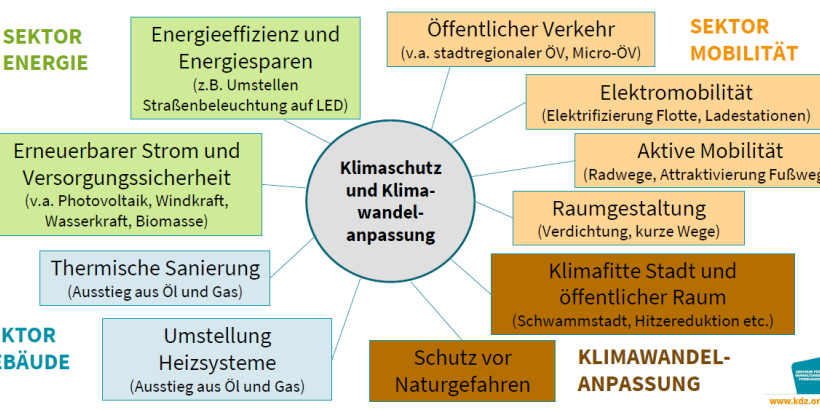Zahlreiche Vereine, etwa im Sport- und Kulturbereich, aber auch wichtige Dienstleistungen wie Rettung, Feuerwehr oder Kinderbetreuung werden von den Gemeinden über Förderungen mitfinanziert. Gerade jetzt in der Krise erhalten kommunale Förderungen eine besondere Bedeutung. Soll hier gespart werden, da es sich „nur“ um Ermessensausgaben handelt? Oder sollen diese sogar aufgestockt werden, um das gesellschaftliche Leben durch die Krise hindurch zu sichern?
Zum zweiten Mal erstellte das KDZ im Auftrag des Österreichischen Städtebundes eine Studie zu den von Gemeinden vergebenen Förderungen[1]. Im Mittelpunkt steht dabei eine Analyse nach Zweck der Förderungen (Aufgabenbereich) und wer diese erhält (Fördernehmer). Neben „klassischen“ Förderungen, etwa im Sport- und Kulturbereich, bestehen Förderungen auch zur Sicherstellung von wichtigen Infrastrukturen und Dienstleistungen – etwa die Finanzierung des Rettungswesens, der Feuerwehren oder der Kinderbetreuung.
1,5 Mrd. Euro an Förderungen, v.a. für Bildung, Kultur und Sport
Insgesamt lagen die Ausgaben für Förderungen im Jahr 2018 bei 1,5 Mrd. Euro (alle Werte ohne Wien). Dies entspricht 7 Prozent der Gesamtausgaben der Gemeinden.
Betrachtet man die Förderausgaben nach Aufgabenbereichen (Abbildung 1) zeigen sich die folgenden betragsmäßig wichtigsten Bereiche: Daseinsvorsorge[2] (327 Mio. Euro bzw. 21 Prozent), Bildung (242 Mio. Euro bzw. 17 Prozent), Kultur & Sport (267 Mio. Euro bzw. 17 Prozent) und Soziales (195 Mio. Euro bzw. 13 Prozent, v.a. Förderungen sozial schwacher Personen, Sozialhilfeleistungen der Statutarstädte in der Steiermark und in Oberösterreich).
Nur 29 Prozent sind „klassische“ frei verfügbare Förderungen
Beim weit überwiegenden Teil der Förderausgaben handelt es sich um Ausgaben, welche mit verpflichtenden Kommunalleistungen oder mit organisatorischen Gegebenheiten in Zusammenhang stehen. Hier besteht daher wenig Einsparungspotenzial. Dies betrifft Zahlungen an gemeindeeigene Gesellschaften (etwa den Dienstleistungsbereich mit Schwimmbädern, Kultureinrichtungen etc.), aber auch konkrete Verträge mit NPOs (etwa private Kinderbetreuungseinrichtungen, Rettungswesen, Feuerwehr).
Über 29 Prozent der Förderausgaben können die Gemeinden im Wesentlichen frei verfügen. Dies trifft insbesondere auf die Kultur- und Sportförderung sowie die Wirtschaftsförderung, teilweise auch auf Förderungen im Sozialbereich zu. Doch auch hier ist der faktische Handlungsspielraum nicht immer gegeben.
Deutliche Bundeslandspezifika
Zwischen den Bundesländern bestehen beträchtliche Unterschiede hinsichtlich der durchschnittlichen Förderhöhe pro Kopf (zwischen 68 und 258 Euro). Dies ist jedoch nur teilweise auf unterschiedliche Förderstrategien zurückzuführen. Entscheidend sind auch unterschiedliche institutionelle und rechtliche Rahmenbedingungen in den Bundesländern. Auch werden gemeindeeigene Gesellschaften in sehr unterschiedlichem Maße genutzt. Dadurch ist ein direkter Vergleich der Bundesländer nur eingeschränkt möglich.
Die Coronakrise stellt die Gemeinden vor große finanzielle Herausforderungen. Sowohl für 2020 als auch für 2021 ist absehbar, dass die Einnahmen gegenüber 2019 um mindestens 10 Prozent niedriger sein werden.[3] Dem Verlust an Einnahmen steht aber keine Ausgabenreduktion im gleichen Ausmaß gegenüber. Dies ist darin begründet, dass Gemeinden wichtige Grundversorgungsleistungen (z.B. Ver- und Entsorgung, Schulen, Kindergärten) auch in der Krise erbringen müssen und von den Kurzarbeitsregelungen ausgeschlossen sind.
Gemeinden stehen daher verstärkt vor der Frage, wo sie sparen können. In Diskussion sind dabei jene Förderungen, bei welchen man einen hohen Anteil an Ermessensausgaben erwarten kann. Die wichtige Frage, ob das Sparen im Bereich der Förderungen sinnvoll ist, gilt es nun politisch zu diskutieren.
Beschränkte Einsparmöglichkeiten der Gemeindeebene bei Förderungen
Die vorangehenden Ausführungen zu den Förderungen zeigen, dass der Ermessensspielraum bei Förderungen nicht allzu hoch ist. Beim weit überwiegenden Teil der als Förderungen ausgewiesenen Ausgaben handelt es sich um Ausgaben zur Gewährleistung der gesetzlich vorgegebenen kommunalen Leistungen (rund 1,1 Mrd. Euro). Nur rund 450 Mio. Euro betreffen „klassische“ Förderbereiche wie Kultur, Sport, Wirtschaft und Soziales.
Kommunale Förderungen als Steuerungsinstrument in der Coronakrise
Dennoch ist das kommunale Fördervolumen eine nicht zu unterschätzende Größe; wird doch mit Förderungen das Zusammenleben in den Gemeinden aufrechterhalten und gefördert. Gerade in Corona-Zeiten stehen viele Vereine vor großen Herausforderungen, da Einnahmen durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie wegfallen. Die Vereine sind daher gerade jetzt auf öffentliche Unterstützungen angewiesen.
Auch haben sehr viele Gemeinden Hilfspakete für die Wirtschaft und für Menschen in sozialen Notlagen geschnürt. So wurden etwa zusätzliche Förderungen an Unternehmen vergeben (etwa für Jungunternehmer) oder Mietzahlungen gestundet, reduziert oder erlassen. Auch wurden in vielen Gemeinden erstmals Einkaufsgutscheine zur Stützung der Wirtschaft im Ort eingeführt. Für Menschen in sozialen Notlagen wurde das Fördervolumen aufgestockt.
Mit kommunalen Förderungen wird daher auch ein Beitrag zur Bewältigung der Coronakrise geleistet. Das Ansetzen des Sparstiftes ist daher vielfach nicht möglich und auch oftmals nicht sinnvoll. Ein Sparen wird vielmehr direkte negative Auswirkungen auf die Bürgerinnen und Bürger haben.
Autorinnen: Dr.in Karoline Mitter, DIin Nikola Hochholdinger
[1] KDZ: Prognose der Gemeindefinanzen 2020 und 2021 [download 1.10.2020]
[2] Mitterer/Hochholdinger: Kommunaler Förderbericht 2020, 2020.
[3] Daseinsvorsorge gemäß Rechnungsabschluss Gruppe 8, daher vorrangig gemeindeeigene Gesellschaften, z.B. Kultur- und Sportbereich.