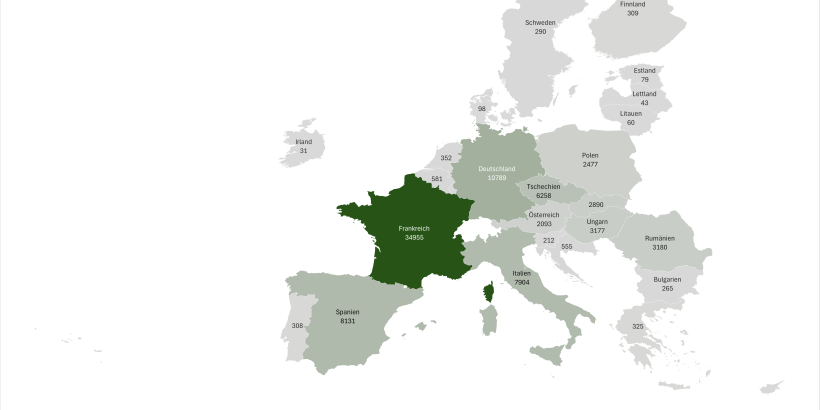Im Zuge der Zwischenbewertung (Midterm Review) der Kohäsionspolitik 2021-2027 unterstreicht die Europäische Kommission in ihrer Mitteilung A modernised Cohesion policy: The mid-term review die Notwendigkeit, das wichtigste Investitionsinstrument der EU stärker auf die aktuellen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen auszurichten.
Ein zentrales Element der Mitteilung ist die stärkere Fokussierung auf die politischen Prioritäten der EU. Dazu gehören insbesondere der grüne und digitale Wandel und die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Konkret werden folgende Schwerpunkte für die Reform der Kohäsionspolitik vorgeschlagen:
- Schließen der Innovationslücke, erhöhen der Wettbewerbsfähigkeit und Dekarbonisierung vorantreiben
- Verteidigung und Sicherheit stärken
- Leistbares Wohnen ermöglichen
- Wasserresilienz stärken
- Energiewende vorantreiben
- Grenzregionen im Osten unterstützen
- Wohlstand und das Recht, in allen Regionen leben zu können, mit maßgeschneiderten Politiken zu stärken.
Die für Städte und Gemeinden wichtigsten Änderungen sind wie folgt:
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch Innovation
Die Kommission schlägt vor, die bestehenden Programme stärker auf zukunftsorientierte Schlüsselbereiche wie künstliche Intelligenz, digitale Technologien, grüne Industrie, Biotechnologie, Raumfahrt und Verteidigungstechnologien auszurichten. Dazu sollen Mitgliedstaaten ihre Kohäsionsprogramme gezielt anpassen und Mittel in sogenannte STEP-Projekte (Strategic Technologies for Europe Platform) umleiten können. Neu ist dabei, dass solche Investitionen in allen Regionen möglich werden – auch in „stärker entwickelten Regionen“ wie Österreich.
Für Städte bedeutet das eine enorme Chance: Sie beherbergen häufig Universitäten, Forschungseinrichtungen, innovative Start-ups sowie hochqualifizierte Arbeitskräfte – ideale Voraussetzungen, um als regionale Innovationsknotenpunkte zu agieren. Durch gezielte Förderungen, etwa für High-Tech-Cluster, städtische Reallabore oder die Digitalisierung öffentlicher Dienste, können städtische Räume gestärkt und ihre Wettbewerbsfähigkeit ausgebaut werden. Investitionen in digitale Infrastruktur – etwa Cloud-Dienste, KI-Anwendungen oder smarte Verwaltungsdienste – sind Teil dieses Innovationsschubs.
Leistbares Wohnen
Die Kommission schlägt vor, den bisherigen Finanzierungsrahmen deutlich zu erweitern: Die Mitgliedstaaten sollen die Möglichkeit erhalten, die Mittel für leistbares Wohnen im Rahmen ihrer Kohäsionsprogramme zu verdoppeln. Um dies zu erleichtern, werden neue spezifische Förderziele eingeführt, die den Investitionsrahmen auf verschiedene Programmachsen ausweiten. Gleichzeitig werden Anreize geschaffen: Reallokationen zugunsten des Wohnungsbaus sollen von der EU zu 100% gefördert, die Vorfinanzierung mit 30 % EU-Kofinanzierung unterstützt werden.
Die Kommission hat außerdem gemeinsam mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) ein Finanzinstrument erarbeitet, das es ermöglicht die Mittel der Kohäsionspolitik mit Mitteln der EIB und anderen internationalen Finanzinstitutionen, sowie nationalen Förder- und Geschäftsbanken zu kombinieren, um Investitionen in erschwinglichen Wohnraum zu unterstützen. Städte sollen zudem durch die Verknüpfung mit der Neuen Europäischen Bauhaus-Initiative (NEB) gestärkt werden, welche nachhaltiges Bauen, soziale Inklusion und ästhetische Qualität verbindet.
Anzumerken ist an dieser Stelle, dass Österreichs Städte und Gemeinden aktuell noch nicht von diesen Reformen profitieren können, da hierzulande für die Förderperiode 2021-2027 keine EU-Mittel für Wohnen programmiert wurden bzw. aufgrund der EU-Verordnung für den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) programmiert werden konnten. Durch die neue Schwerpunktsetzung in der Kohäsionspolitik könnten sich für die neue Förderperiode allerdings Potenziale auftun.
Dies auch vor dem Hintergrund, dass die Mitteilung die zentrale Rolle von Städten und Gemeinden bei der Umsetzung betont und anerkannt, dass gerade Städte mit zielgerichteter politischer Steuerung, Planungskompetenz und lokalem Wissen maßgeblich zur Lösung der Wohnraumkrise beitragen können.
Der im Europäischen Parlament im Januar 2025 eingesetzte Sonderausschuss zur Wohnraumkrise (HOUS) soll unter dem Vorsitz der italienischen Abgeordneten Irene Tinagli (S&D - Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten) die Ursachen der Wohnungskrise untersuchen und politische Empfehlungen für mögliche Lösungen auf EU-Ebene erarbeiten. Österreichischer Vertreter im Sonderausschuss ist MEP Andreas Schieder. Darüber hinaus arbeitet die EU an einen gemeinsamen europäischen Plan für leistbares Wohnen, welcher auch auf den Erkenntnissen des Sonderausschusses aufbauen wird.
Energiewende
Ein zentraler Schwerpunkt der Kohäsionspolitik ist der Klimaschutz und die grüne Transformation – mit über 110 Milliarden Euro an Investitionen. Gefördert werden unter anderem Energieeffizienz, erneuerbare Energien, saubere Mobilität und moderne Infrastruktur. So fließen etwa 24 Milliarden Euro in Energieeffizienz, auch im Wohnbereich, und mehr als 15 Milliarden Euro in saubere Energiequellen.
Um die Energiesicherheit zu stärken und die Energiewende voranzutreiben, schlägt die Kommission neue Förderziele vor, u. a. für Stromnetze, Speicher, Ladeinfrastruktur und Energiegenossenschaften. Diese Investitionen sollen ab 2026 besonders attraktiv gestaltet werden, indem die Vorfinanzierung zu 30 % von der EU und die Umsetzung zu 100 % gefördert werden.
Mitgliedstaaten und Regionen werden aufgefordert, ihre Programme neu auszurichten und Investitionen in Clean-Tech, industrielle Transformation, Klimaanpassung und lokale Energiegemeinschaften zu verstärken – auch im Sinne des Clean Industrial Deal und des Affordable Energy Action Plan.
Politiken für den Wohlstand und das Recht, in allen Regionen zu leben
Die EU-Kommission reagiert mit ihrer Kohäsionspolitik auf die ungleichmäßigen Auswirkungen von wirtschaftlichen und geopolitischen Veränderungen in Europa. Ziel ist es, allen Menschen das Recht zu sichern, in ihrer Heimatregion zu bleiben, durch Zugang zu Arbeit und grundlegenden Dienstleistungen. In ländlichen und strukturschwachen Regionen sollen Programme wie LEADER der und nachhaltiger Tourismus neue wirtschaftliche Perspektiven schaffen. Zudem sollen die Programme der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP), welche die Entwicklung der ländlichen Räume unterstützen, mit jenen der Kohäsionspolitik stärker verknüpft werden (Stichwort: Komplementarität) – auch um Stadt-Land-Verbindungen und funktionale Räume zu stärken.
Auch Städte stehen vor großen Herausforderungen, etwa beim bezahlbaren Wohnraum, gesellschaftlicher Integration, Verkehr und Umweltbelastung. Daher investiert die EU rund 24 Milliarden Euro in die urbane Entwicklung, mit Städten als treibende Kraft für Klimaschutz und Dekarbonisierung. Die Kommission möchte die Rolle der Städte gezielt stärken – insbesondere durch die Ausweitung der Europäischen Städte-Initiative.
Mitgliedstaaten sollen künftig EFRE-Mittel in diese Initiative umschichten können, um städtische Innovationsprojekte gezielter zu fördern. Zusätzlich soll ein „Seal of Excellence“ für Projekte geschaffen werden, die förderwürdig sind, bisher aber nicht finanziert werden konnten. Damit wird die Möglichkeit geschaffen, auch diese Projekte mit EFRE-Mitteln zu finanzieren.
Bessere Verwaltung – weniger Bürokratie der Programme?
Um die Wirkung der Kohäsionspolitik weiter zu steigern, setzt die Reform auf vereinfachte Kostenmodelle, einen flexibleren Umgang mit thematischen Konzentrationsvorgaben sowie eine Verlängerung der Förderperiode für umprogrammierte Mittel. Gleichzeitig sollen Projekte des Wiederaufbaufonds RRF, die bis 2026 nicht vollständig umgesetzt werden konnten, in die jeweiligen kohäsionspolitischen Programme übergeführt werden können.
Insgesamt verfolgt die Reform das Ziel, die Kohäsionspolitik als strategisches Investitionsinstrument der EU neu zu positionieren: zielgerichteter, moderner, krisenresilienter – und besser verzahnt mit den langfristigen Ambitionen für ein sozial gerechtes, wettbewerbsfähiges und nachhaltiges Europa.
Mit der Mitteilung hat die Europäische Kommission auch gleich einen Vorschlag für die neue Verordnung vorgelegt[1]. Ziel ist es, dass die Mitgliedstaaten die Neu-Programmierung im Rahmen der Midterm Review bis spätestens Ende 2025 abschließen.
[1] Proposal for Regulation amending Regulation (EU) 2021/1058 and (EU) 2021/1056 as regards specific measures to address strategic challenges in the context of the mid-term review