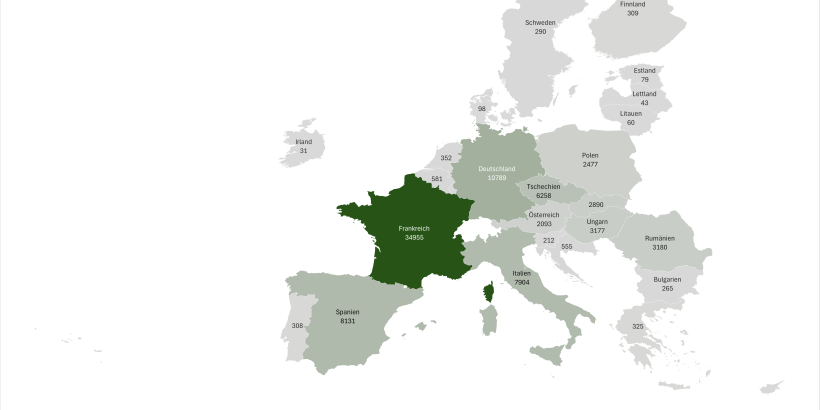Die Umsetzung der Sustainable Development Goals (SDGs) ist längst nicht mehr allein Aufgabe von Nationalstaaten und internationalen Organisationen. Gerade Städte stehen an vorderster Front, wenn es darum geht, globale Nachhaltigkeitsziele auf lokaler Ebene erfolgreich umzusetzen. Doch wie lässt sich Nachhaltigkeit in die finanziellen und administrativen Strukturen von Stadtverwaltungen verankern? In aktuellen Studien wird beleuchtet, wie erste Schritte in der SDG-Rechnungslegung und Haushaltsplanung aussehen – und welche Herausforderungen es gibt.
Städte als Haupthandelnde der SDGs
Fachpersonen schätzen, dass rund 65 % der SDG-Ziele direkt und indirekt durch Maßnahmen auf lokaler Ebene erreicht werden können. Städte spielen damit eine zentrale Rolle in der Umsetzung der Agenda 2030. Doch während viele Städte und Gemeinden bereits Nachhaltigkeitsstrategien formuliert haben, stellt sich eine entscheidende Frage: Wie lassen sich Nachhaltigkeitsziele in Haushaltspläne und Finanzierungsmodelle integrieren? Hier setzt die Idee der „Glocalization“ an – ein Begriff, der beschreibt, wie globale Nachhaltigkeitsziele an lokale Gegebenheiten angepasst werden. In der Praxis bedeutet das: Stadtverwaltungen müssen ihre finanziellen, strategischen und administrativen Ziele und Maßnahmen mit den SDGs in Einklang bringen.
Die Nachhaltigkeit einer Stadt ist ein komplexes Entscheidungsproblem, das viele Variablen umfasst und hauptsächlich von den Präferenzen der Entscheidungstragenden abhängt.
Erste Schritte in der SDG-Rechnungslegung: was Städte bereits tun
Ob in Amsterdam, Helsinki oder Barcelona – immer mehr Städte beginnen, ihre Haushaltsplanung mit den SDGs zu verknüpfen. Es gibt drei zentrale Ansätze, die sich abzeichnen:
- SDG-Tagging: Einige Städte setzen auf das sogenannte SDG Budget Tagging. Dabei werden öffentliche Ausgaben bestimmten SDGs zugeordnet, um transparent zu machen, wie viel Geld tatsächlich in nachhaltige Entwicklung fließt.
- Indikatorenbasierte Planung: Städte und Gemeinden entwickeln SDG-spezifische Leistungsindikatoren, um den Fortschritt nachaltiger Maßnahmen messbar zu
machen. So kann überprüft werden, ob etwa Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr wirklich zur Reduktion von CO2-Emissionen beitragen (SDG 13: Klimaschutz). Steuerung (Governance) mit SDGs: Wenn SDGs lediglich nachträglich be stehenden Budgetposten zugeordnet werden, bleiben sie oft symbolisch, ohne echte Lenkungswirkung. Wirkliche Transformation entsteht dann, wenn sie bereits bei der Ziel- und Maßnahmenplanung als Handlungsrahmen einbezogen werden – also ex ante, nicht nur ex post. Eine wirksame SDG-Steuerung erfordert ihre Integration in den gesamten Haushaltskreislauf – nicht nur als nachträgliche Zuordnung, sondern als Grundlage für Zielsetzung und Ressourcenverteilung.
Performance Budgeting kann hierbei unterstützen, indem es Wirkungsziele mit SDG-Beiträgen verknüpft und so echte Lenkung statt symbolischer Zuordnung ermöglicht.
- Berichterstattung & Transparenz: Nachhaltigkeitsberichte gewinnen in vielen Städten an Bedeutung. Ziel ist es, die SDG-Umsetzung nicht nur strategisch zu
planen, sondern auch regelmäßig zu dokumentieren und für Bürgerinnen und Bürger zugänglich zu machen.
Hürden auf dem Weg zur nachhaltigen Finanzplanung
Ein Problem ist die fehlende Standardisierung: Eine einheitliche Methodik zur Erfassung SDG-relevanter Haushaltsausgaben fehlt, sodass Städte in dividuelle Verfahren entwickeln, was Vergleichbarkeit und Skalierbarkeit erschwer. Der Zielkonflikt zwischen kurzfristigen politischen Prioritäten und langfristiger Nachhaltigkeit: Durch die Logik von Wahlzyklen und kurzfristigen Finanzierungsentscheidungen werden die strategischen Ansprüche der SDGs nicht selten vernachlässigt.
Auch die unzureichende Datenverfügbarkeit stellt ein Hemmnis dar – viele Städte und Gemeinden haben weder belastbare Indikatoren noch systematische Analysemöglichkeiten. Oft fehlen die notwendigen Ressourcen und Fachkenntnisse, um eine SDG-orientierte Haushaltsführung wirksam umzusetzen.
Was kommt als Nächstes? Die Zukunft der SDG-Budgetierung
Trotz aller Hindernisse steht außer Frage: Eine echte Umsetzung der SDGs erfordert, dass Nachhaltigkeit zum integralen Bestandteil kommunaler Haushaltsstrategien wird. Fachleute unterstreichen dies mit konkreten Forderungen:
- Standardisierte Methoden für SDG-Budgetierung entwickeln, um Städte besser vergleichbar zu machen.
- Bessere Koordination zwischen lokalen und nationalen Behörden
- Digitale Tools und KI nutzen, um SDG-Ausgaben effizienter zu tracken und zu analysieren.
- Mehr Bürger*innenbeteiligung, um öffentliche Mittel für SDG-relevante Projekte demokratischer zu verteilen.
Nur durch strukturelle Weichenstellungen lässt sich verhindern, dass ambitionierte Ziele an mangelnder Umsetzbarkeit scheitern.
Beispiele aus dem Norden
Nachhaltigkeit ist nur dann wirksam, wenn ökologische, soziale und wirtschaftliche Maßnahmen nicht isoliert betrachtet, sondern als interdependente Elemente einer ganzheitlichen Strategie verstanden werden. Die Erfahrungen aus Kristiansund (FIN) zeigen: Alle Handelnden – von der Verwaltung bis zur Bürgerschaft – müssen an Bord sein, um langfristig tragfähige und gerechte Gemeinschaften zu schaffen.
Der Prozess erfordert Zeit: In Finspång dauerte es drei Jahre, bis die SDGs in den Haushalt und die strategische Planung integriert wurden. Politischer Wille und Geduld sind essenziell, um eine nachhaltige Governance zu etablieren. Fortschritt sollte dabei nicht als Wettbewerb zwischen Städten und Gemeinden verstanden werden – jede Stadt entwickelt individuelle Lösungen im eigenen Tempo.
Fazit: Nachhaltigkeit als neue DNA kommunaler Governance
Städte und Gemeinden spielen eine entscheidende Rolle bei der Verwirklichung der Agenda 2030. Die Integration der SDGs in die kommunale Steuerung ist kein Sprint, sondern ein Marathon – doch mit einer klaren Roadmap und starkem Engagement kann jede Gemeinde ihren Beitrag zu einer lebenswerten Zukunft leisten.