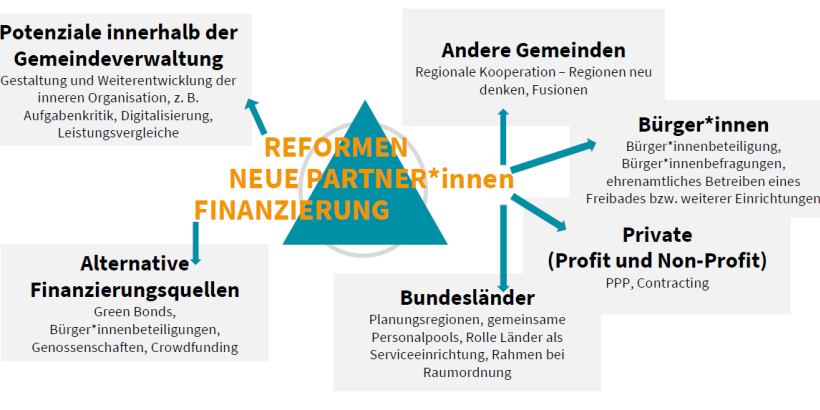In welchem Ausmaß die ökosoziale Steuerreform die finanziellen Spielräume der Gemeinden einschränken wird, hängt von mehreren Faktoren ab. Von besonderer Bedeutung wird sein, wie sich die Wirtschaft in den nächsten Jahren entwickelt und ob die Deckelung bei den Ertragsanteilen im Zuge des 2. Gemeindepaketes entfällt. Feststehen dürfte, dass die Gemeinden die Steuerreform mittragen müssen und ihnen daher Mindereinnahmen entstehen, welche ihnen nicht ersetzt werden.
Welche Mindereinnahmen sind für Gemeinden durch die Steuerreform zu erwarten?
Von 2022 bis 2025 ist von Mindereinnahmen für die Gemeinden inkl. Wien[1] von voraussichtlich insgesamt rund 1,9 Mrd. Euro[2] bzw. 200 bis 600 Mio. Euro p.a. auszugehen, denn ein wesentlicher Teil der Steuerreform muss von Bund, Ländern und Gemeinden gemeinsam getragen werden. Insbesondere die Senkung der Lohn- und Einkommensteuer, der Familienbonus plus sowie die Senkung der Körperschaftssteuer führen zu einem Minus bei den gemeinschaftlichen Bundesabgaben, welche die Grundlage für die Ertragsanteile der Gemeinden bilden. So tragen die Gemeinden knapp 12 Prozent sämtlicher Mindereinnahmen.
Die Steuerreform wird bereits 2022 erste Auswirkungen zeigen, erreicht aber erst ab 2024 ihren Vollausbau. Die Mindereinnahmen für die Gemeinden werden nach den derzeitigen Prognosen im Jahr 2024 bei rund 600 Mio. Euro liegen. Im Vergleich dazu: Die Summe der Ertragsanteile der Gemeinden belief sich 2019 (als Vorkrisenjahr) bei 11 Mrd. Euro. Die Mindereinnahmen 2024 würden damit bei rund 5 Prozent der Ertragsanteile 2019 liegen.
Wird die Steuerreform die ohnehin schon angespannten Gemeindefinanzen weiter belasten?
Die aktuelle Prognose des BMF zur Entwicklung der Ertragsanteile[3] lässt hoffen. Die Abgabenentwicklung 2021 hat sich deutlich besser entwickelt als ursprünglich befürchtet. Womöglich wird der geplante Vorschuss von 1 Mrd. Euro im 2. Gemeindepaket gar nicht gebraucht und er muss damit nicht in den folgenden Jahren zurückgezahlt werden. Dies würde bedeuten, dass die Deckelung der Ertragsanteile für die Folgejahre ebenfalls entfallen würde und sich damit die Ertragsanteile ab 2022 deutlich dynamischer entwickeln würden als noch im Juni 2021 prognostiziert.
Dies hätte den Vorteil, dass sich damit auch eine bessere Ausgangssituation für die Gemeinden in Bezug auf die Steuerreform ergeben würde. So geht die Prognose des BMF von einer sehr positiven Wirtschaftsentwicklung in den nächsten Jahren aus, welche die Nachteile der Steuerreform weitgehend auffangen soll.
Neben den Ertragsanteilen bestehen für die Gemeindefinanzen auch noch andere Unsicherheitsfaktoren. Zu nennen ist insbesondere die dynamische Entwicklung der Umlagen, wo sich aktuell hohe Steigerungsraten in den nächsten Jahren abzeichnen. Auch die möglicherweise dynamische Inflationsentwicklung wäre bei der Bewertung der zukünftigen Entwicklung zu berücksichtigen. Das KDZ plant die nächste Aktualisierung der Prognose der Gemeindefinanzen für Dezember 2021 mit einer Einschätzung der finanziellen Spielräume der Gemeinden für die nächsten Jahre.
Werden die Gemeinden auch von der CO2-Abgabe profitieren?
Die Mehreinnahmen der CO2-Abgabe werden für die Ausschüttung des Klimabonus verwendet, womit die Gemeinden nicht von der CO2-Abgabe profitieren werden. Die CO2-Abgabe ist auch nicht als gemeinschaftliche Bundesabgabe konzipiert und kommt daher nur dem Bund zugute.
Gleichzeitig werden den Gemeinden durch die CO2-Abgabe Mehrausgaben entstehen.
Im Sinne einer ökosozialen Steuerreform wäre eine (zumindest teilweise) Zweckwidmung der CO2-Abgabe für klimafreundliche Maßnahmen und Investitionen sinnvoll gewesen (z.B. Ausbau des öffentlichen Verkehrs, thermische Sanierungen). Dass die Einnahmen der CO2-Abgabe vollständig für den Klimabonus verwendet werden und nicht zumindest teilweise zweckgewidmet für klimafreundliche Investitionen verwendet werden, kann daher kritisch gesehen werden. Nach wie vor gibt es keine gesicherten Fördertöpfe für den städtischen öffentlichen Verkehr. Auch durch eine gezielte Förderung der thermischen Sanierung bei öffentlichen Gebäuden wären große Potenziale für das Klima entstanden.
Zusammenfassend
Insgesamt lässt sich mit den heute verfügbaren Daten zur BMF-Prognose der Ertragsanteile ein deutlich optimistischeres Bild zeichnen als noch vor wenigen Wochen und Monaten. Dennoch wird die Steuerreform die Einnahmendynamik der Gemeinden bremsen, insbesondere im Hinblick auf die starke Ausgabendynamik in den Bereichen Soziales und Gesundheit wie auch inflationsbedingt innerhalb der kommunalen Aufgabenbereiche. Eine nachhaltige Finanzierung von Infrastrukturmaßnahmen in den Klimaschutz ist nach wie vor ungelöst.
[1] Bei Wien ist nur der Gemeindeanteil (und daher nicht der Länderanteil) berücksichtigt.
[2] Basierend auf dem Ministerratsvortrag vom 6. Oktober 2021.
[3] So wird in der aktuellen BMF-Prognose vom 15.10.2021 ein Anstieg zwischen 3 und 6 Prozent p.a. bis 2025 erwartet, was um 1 bis 3 Prozentpunkte p.a. über den bisherigen Prognosen liegt.