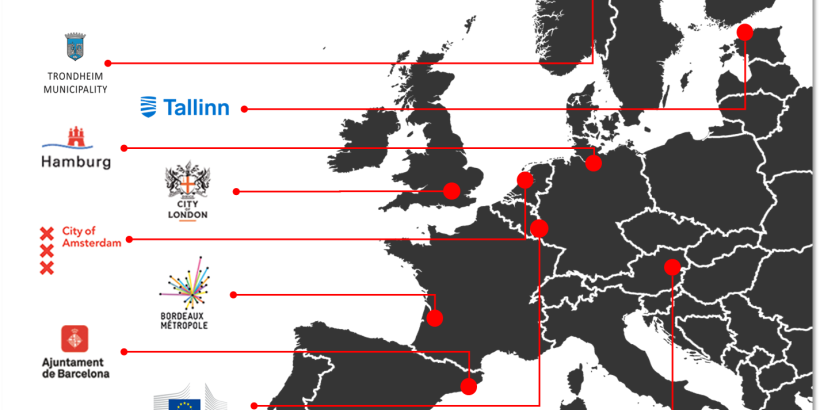Mit der Studie „Local Finances and the Green Transition“ hat der Rat der Gemeinden und Regionen Europas in Kooperation mit dem KDZ einen weiteren Meilenstein für Transparenz in den europäischen Kommunalfinanzen gesetzt. Fazit: Trotz Finanzkrise und COVID-19 Pandemie sind Europas Städte und Gemeinden mit einem blauen Auge davongekommen, nicht zuletzt durch massive öffentliche Finanzhilfen.
Mehr als zehn Jahre ist es her, dass der Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) erstmals die subnationalen Finanzen seiner 40 Mitglieder als Gesamtschau veröffentlicht hat. Zwischenzeitlich hat eine massive Finanz- und Gesundheitskrise Europa durchgebeutelt und auch Europas Städte und Gemeinden gehörig gefordert. Abgesehen davon, die Auswirkungen dieser Krisen für die Menschen bestmöglich abzu federn, galt es auch die Daseinsvorsorge vor Ort aufrechtzuerhalten und abzusichern.
Dass dies größtenteils gelungen ist, bestätigen auch die Ergebnisse der RGRE-Studie: so flossen mehr als drei Viertel der kommunalen
Ausgaben auch im Zeitraum 2010-2020 in die wichtigsten Lebensbereiche der Menschen mit durchschnittlich 22 Prozent in den Bildungsbereich, knappe 17 Prozent in allgemeine öffentliche Dienstleistungen, beinahe 15 Prozent in den Sozialschutz und knappe 10 Prozent in die Gesundheit. Weitere sieben Prozent wurden für Wohnen und etwa sechs Prozent für Umweltschutz ausgegeben.
Die Studie liefert mit länderspezifischen Besonderheiten und Beispielen wertvolle Ansätze für Österreich.
Städte und Gemeinden als wichtige Investoren
Die Studie hat aber auch die Bedeutung von Städten und Gemeinden für öffentliche Investitionen deutlich gemacht. So finanzieren die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in Europa mehr als die Hälfte aller öffentlichen Investitionen, obwohl sie nur ein Viertel der gesamten öffentlichen Ausgaben tätigen. Allerdings gibt es hier große Unterschiede zwischen den Ländern: die Bandbreite reicht von 2,1 Prozent in Malta bis 78,3 Prozent in Belgien. Städte und Gemeinden sind aber auch Vorreiter bei grünen Investitionen: durchschnittlich 73 Prozent der kommunalen Investitionen flossen in den Klimaschutz.
Verschuldung stabil, aber Trend
Bemerkenswert ist, dass die Verschuldung auf lokaler Ebene im Zeitraum 2010-2020 mit durchschnittlich 4,8 Prozent des BIP niedrig und stabil geblieben ist. Zum Vergleich: Die Verschuldung auf gesamtstaatlicher Ebene stieg bis Mitte des Jahrzehnts auf 67 Prozent des BIP, und auf 81 Prozent im Jahr 2020. Letzteres dürfte aber Großteils den staatlichen COVID-19 Ausgaben und Finanzhilfen geschuldet sein. Andererseits zeigt die Studie einen Trend zur Einschränkung der kommunalen Finanzautonomie. Mit dem Indikator „subnationale Ausgaben als Anteil gesamtstaatlicher Ausgaben“ kann der Dezentralisierungsgrad eines Staates gemessen werden. Dieser zeigt, wieviel der gesamten öffentlichen Ausgaben von Gemeinden und Regionen getragen wird. Durchschnittlich ist der Anteil der subnationalen Gebietskörperschaften an den gesamtstaatlichen Ausgaben zwar nur um 1,04 Prozent in den letzten zehn Jahren zurückgegangen, womit die Situation im Allgemeinen trotz Finanz- und COVID-19 Krise stabil geblieben ist. Bei Betrachtung der einzelnen Länder zeigen sich jedoch erhebliche Unterschiede. In zwei Dritteln der Länder ist der Anteil der subnationalen Gebietskörperschaften an den gesamtstaatlichen Ausgaben zurückgegangen mit Ungarn (-12,8 Prozent), Georgien (-7,2 Prozent), Spanien (-6,4 Prozent) und dem Vereinigten Königreich (-5,6 Prozent) an der Spitze.
Kommunale Finanzautonomie in Österreich im europäischen Vergleich unterdurchschnittlich
Bei einem durchschnittlichen Dezentralisierungsgrad von 23,9 Prozent weist Österreich mit 33,1 Prozent auf den ersten Blick einen hohen Dezentralisierungsgrad auf. Zieht man jedoch in Betracht, dass Österreich ein föderaler Staat ist und die subnationalen Ausgaben die Bundesländer mitumfassen, zeigt sich ein anderes Bild: Vergleicht man Österreich mit den anderen föderalen Staaten Belgien (49 Prozent), Deutschland (48,9 Prozent) und Spanien (47,3 Prozent), ergibt sich eine deutlich geringere Dezentralisierung in Österreich. Insgesamt zeigt sich, dass die fiskale Dezentralisierung und damit die Finanzautonomie der österreichischen Städte und Gemeinden im europäischen Vergleich unterdurchschnittlich ausgeprägt ist.

Zusammenfassend bietet die RGRE-Studie einen kompakten Überblick und interessante Vergleichszahlen zum Status der Dezentralisierung, der Zusammensetzung der Gemeindeausgaben, zu kommunalen Investitionen und zur Steuerautonomie der Gemeinden in Europa. Einiges firmiert auch unter Lessons Learned für die Zukunft. Diese nicht zu berücksichtigen, wäre fahrlässig, denn eine Entspannung der Gemeindehaushalte ist nicht in Sicht. Investitionen in Klimaschutz und Klimawandelanpassung sowie in die digitale Transformation beispielsweise haben jedenfalls hohes Potenzial, die Gemeindefinanzen langfristig auf nachhaltige Beine zu stellen. In Österreich könnte zudem eine Stärkung der Eigenfinanzierungsmöglichkeiten der Städte und Gemeinden die Verteilungskämpfe im Finanzausgleich entschärfen und zugleich den kommunalen Handlungsspielraum maßgeblich erweitern.